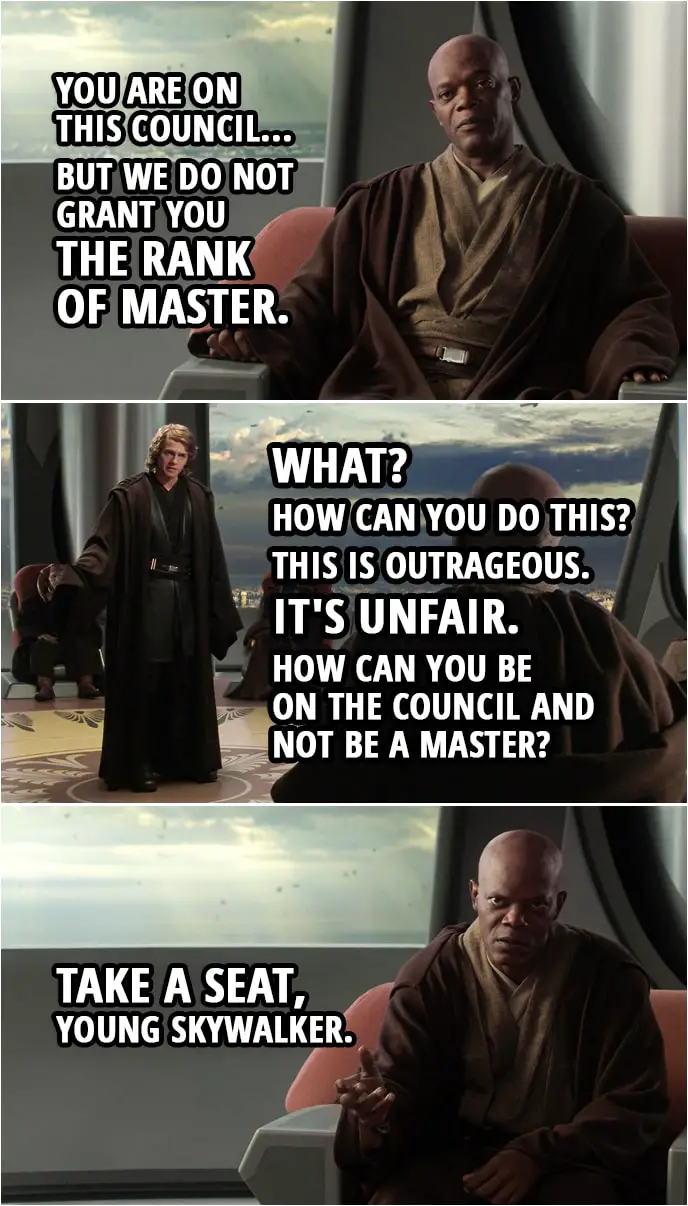Gesegnetes Hochfest des Leibes und Blutes Christi (alias Fronleichnam), liebe Leser! In Berlin, wie auch sonst in weiten Teilen der Republik, ist heute kein gesetzlicher Feiertag, weshalb die "äußere Feier" im Wesentlichen erst am kommenden Sonntag stattfindet; abgesehen natürlich von der zentralen Fronleichnamsfeier des Erzbistums Berlin, die just in dem Moment, da dieses Wochenbriefing online geht, mit einer Messe auf dem Bebelplatz beginnt. Die Erfahrung früherer Jahre hat gelehrt, dass es besser für den Seelenfrieden ist, dieses Event zu meiden; umso mehr freue ich mich auf die Spandauer Fronleichnamsfeier am Sonntag.
Ja, diese Formulierung habe ich schon vor zwei Jahren als Artikelüberschrift verwendet, aber ich finde, wenigstens als Zwischenüberschrift kann ich die heuer ruhig noch einmal aufgreifen; abenteuerlich genug begonnen hat der Monat jedenfalls.
Am Donnerstagabend ging ich, einer spontanen Eingebung folgend, zur Rosenkranzandacht in der Allerheiligenkirche in Borsigwalde; der Hausmeister, den ich vor ein paar Wochen bei Gartenarbeiten auf dem Grundstück von St. Joseph Tegel getroffen hatte, hatte die Andacht vorbereitet, und dank der Mitwirkung des nigerianischen Pfarrvikars beinhaltete die Andacht auch eine Aussetzung des Allerheiligsten und einen Eucharistischen Segen. Ein würdiger Einstieg in den Herz-Jesu-Monat, wie ich finde. Im Anschluss sprach ich noch ein paar Worte mit dem Hausmeister, der mir u.a. sagte, er vermisse unsere Lobpreisandachten. Als ich erwiderte, wenn wir dieses Format wieder aufnähmen, dann am wahrscheinlichsten wohl in Haselhorst, sagte er: "Auch gut – ich würde dafür auch nach Haselhorst kommen." – Tags darauf war der Herz-Jesu-Freitag im Herz-Jesu-Monat, was ich zum Anlass nahm, für gut eine halbe Stunde in Herz Jesu Tegel zur Anbetung zu gehen – auch wenn ich diese Kirche am liebsten nur noch betreten würde, wenn sonst niemand dort ist (meine Liebste betritt sie überhaupt nicht mehr).
So richtig fingen die Abenteuer dann aber am Samstag an. Zunächst einmal fand im Garten von St. Stephanus die zweite Wichtelgruppen-Schnupperstunde statt; mit dabei war diesmal eine junge Mutter, die den Vorschlag äußerte, eine an die Wichtelgruppe angegliederte Kleinkindergruppe – insbesondere für jüngere Geschwister der Wichtel und Wölflinge – zu gründen und zu betreuen. Das kommt natürlich auch uns sehr gelegen, da unser Jüngster mit seinen gerade mal zwei Jahren ja eigentlich auch noch deutlich zu jung für die Wichtel ist; zudem verstanden wir uns ausgesprochen gut mit der jungen Dame, und auch sonst verlief die zweite Schnupperstunde wieder recht erfreulich.
Im Anschluss an die Wichtelgruppenstunde entschieden wir uns nach kurzem Überlegen, noch nach Friedrichshain zur "Fiesta Kreutziga" zu fahren, und ließen uns in diesem Ansinnen auch dadurch nicht beirren, dass die Kinder unterwegs einschliefen. Wir fuhren mit der Ringbahn bis Storkower Straße, dort wurden die Kinder munter, und wir schlenderten bei herrlichstem Frühsommerwetter in Richtung Frankfurter Allee.
Ein Gefühl wie Urlaub. Ich glaube, soweit man mich überhaupt als Berliner bezeichnen kann, bin ich im Herzen vor allem Friedrichshainer.
Auf dem Straßenfest selbst war's leider weniger idyllisch. Vielleicht waren wir einfach nur zu spät dran: Wir sahen einige Kinder mit geschminkten Gesichtern und Luftballons, was darauf schließen ließ, dass es ein Kinderprogramm gegeben hatte, das nun aber offenbar schon vorbei war; die Atmosphäre war geschwängert von Zigarettenrauch, schon getrunkenem Bier und (in vergleichsweise geringerem Ausmaß) Gras, fast alle Leute waren schwarz gekleidet und wirkten, gelinde gesagt, nicht sehr fröhlich. Das habe ich aus früheren Jahren anders in Erinnerung. Auffällig war auch, dass ich fast niemanden sah, den ich "von früher her" kannte. Okay, einige meiner ehemaligen Bekannten sind tot, andere vielleicht weggezogen. Und wie gesagt, vielleicht hätte das Straßenfest einen weniger trübseligen Eindruck auf mich gemacht, wenn wir zu einer früheren Uhrzeit dort aufgetaucht wären; aber mir drängt sich dennoch der Eindruck auf, dass das Milieu, in dem Veranstaltungen wie die "Fiesta Kreutziga" oder "Suppe & Mucke" gedeihen und blühen konnten, zum einen durch Corona, zum anderen durch die fortschreitende Spaltung der linken Szene durch immer extremere und absurdere identitäre Ideologien erheblichen Schaden genommen hat.
Immerhin, der Besuch beim "Schenkladen"-Stand lohnte sich, denn dort fanden wir einen neuen Kinderzimmerteppich.
Tags darauf war Dreifaltigkeitssonntag und zudem "Familientag" in St. Stephanus; da wollten wir natürlich hin, also gingen wir auch in St. Stephanus zur Messe – und zwar um 9:30 Uhr, da wir schlichtweg nicht mitgekriegt hatten, dass um 11 Uhr noch eine weitere Messe, als Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder, auf dem Programm stand. Etwas Gutes hatte es indes doch, dass wir in die frühere Messe gingen, aber darauf komme ich später; erst einmal zu dem nicht so Guten: Außer uns waren fast nur alte Leute in der Messe, von denen uns einige schon bei unserem Eintreten deutlich zu verstehen gaben, dass sie die Anwesenheit einer Familie mit kleinen Kindern als störend empfanden. Kurz gesagt, wir konnten mal wieder Stoff für den noch ausstehenden Blogartikel meiner Liebsten sammeln, und das, obwohl die Kinder sich während des größten Teils der Messe wirklich untadelig benahmen.
Zelebriert wurde die Messe von einem Ruhestandsgeistlichen aus Falkensee, der wie wohl recht viele Priester seiner Altersklasse (er ist, wie er nebenbei erwähnte, Geburtsjahrgang 1952) der Auffassung zu sein schien, das Wichtigste an der Messe sei das, was er den Leuten zu sagen habe: Schon seine Begrüßungsworte waren im Grunde eine Predigt, nach dem Schlusssegen hielt er dann noch einen Vortrag über eine Pilgerreise nach Lourdes, an der er über Pfingsten teilgenommen hatte, und die eigentliche Predigt bestand aus exegetischen Spitzfindigkeiten und Ausführungen zur Dogmengeschichte, sehr gelehrt und "linkshirnig". Kein Wunder, dass die Kinder da unruhig wurden. Als das Tochterkind mittendrin anfing, die Kreuzwegstationen an den Wänden zu betrachten und mit halblauter Stimme zu rekapitulieren, was sie vom Inhalt der einzelnen Stationen behalten hatte, sah ich überhaupt nicht ein, wieso ich sie dabei hätte unterbrechen sollen: Ich fand, das hatte mehr spirituelle und katechetische Substanz als das, was der Priester vorne erzählte.
Übrigens, da wir gerade bei #CatholicParentingGoals sind, hier noch eine kleine Anekdote außerhalb der chronologischen Reihenfolge: Am Freitagnachmittag hatte das Tochterkind eine Spielverabredung mit einem etwa gleichaltrigen Freund, und hinterher erzählte sie mir, sie habe beim Schaukeln mit ihm darüber gesprochen, dass man ein neues Leben bekommt, wenn man an Jesus glaubt. Ganz schön beachtlich für eine Fünfjährige, finde ich...!
Nun aber zurück zum Sonntag: Das Gute daran, dass wir früh in der Messe gewesen waren, war, dass wir anschließend bis zum Beginn des Familientags-Programms noch zur EFG The Rock Christuskirche gehen konnten, wo wir üblicherweise mittwochs zum JAM gehen. Dort sind die Sonntagsgottesdienste meist nachmittags, einmal im Monat jedoch – und so auch an diesem Sonntag – um 11 Uhr. Meine Liebste ging mit unserem Jüngsten in den Eltern-Kind-Raum, während ich mit dem Tochterkind zur Kinderkatechese ging. Diese wurde – wie man sich ja schon denken konnte – von Mitarbeitern geleitet, die wir (und die uns) schon vom JAM kannten, und einige der teilnehmenden Kinder kannten wir ebenfalls dorther. Zuerst gab's Kinderlobpreis mit Bewegungsliedern, danach ging es um Gideons Sieg über die Midianiter. Ich machte mir mental so allerlei Notizen, zumal ich – wie an dieser Stelle verraten sei – kürzlich angefragt worden bin, in der Gemeinde St. Joseph/St. Stephanus im Arbeitskreis für Kinderwortgottesdienste mitzuarbeiten.
Um 12 gingen wir dann wieder über die Straße zum Gemeindezentrum von St. Stephanus. Der Familientag war ausgesprochen gut besucht, sehr viel besser als die erste Veranstaltung dieser Art vor rund drei Monaten; ich bekam allerdings vom Erwachsenenprogramm so gut wie nichts mit, da ich praktisch die ganze Zeit beim Kinderprogramm involviert war.
 |
| Die Katze, die es sich zu den Füßen der Muttergottes im Pfarrgarten gemütlich gemacht hatte, zog zeitweilig erhebliche Aufmerksamkeit seitens der Kinder auf sich. |
 |
| Aus Datenschutzgründen nur ein Symbolbild "mit ohne Leute drauf". |
Im Übrigen kam am Rande des Familientags eine mehrfache Mutter auf mich zu und äußerte Interesse an der Wichtelgruppe. Ich würde sagen, die ganze Sache entwickelt sich recht vielversprechend.
Am Montag war wie üblich "Omatag"; diesmal trafen wir (d.h. die Kinder und ich) uns mit meinen Schwiegermüttern im Botanischen Volkspark Blankenfelde-Pankow, zu dessen Attraktionen einerseits der Weltacker zählt – ein Projekt, von dem ich vor Jahren in einer Broschüre der Katholischen Landjugendbewegung Bayerns (!) gelesen und daraufhin einmal mit meiner damals noch sehr kleinen Tochter einen Ausflug dorthin gemacht hatte –;
und andererseits ein Damwildgehege.
Zu diesen Themen will ich mich in dieser Ausgabe des Wochenbriefings mal einigermaßen kurz fassen; einerseits, weil es da so besonders viel Neues im Augenblick nicht gibt, und andererseits, weil dieser Artikel auch ohnedies schon lang genug zu werden verspricht. In Tegel traf ich am Montag, bevor ich mit den Kindern zum "Omatag" aufbrach, den oben bereits erwähnten nigerianischen Pfarrvikar und eine Frau aus der Gemeinde, nämlich dieselbe, die wir am Pfingstsonntag in St. Afra gesehen hatten. Ein konspiratives Treffen war das nicht gerade, wir liefen uns einfach so über den Weg. Aber ein interessantes Gespräch ergab sich daraus allemal.
In St. Willehad hat derweil Pfarrer Karl Jasbinschek am Pfingstmontag sein 40jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Interessant finde ich daran vor allem, dass der Geistliche in einem leider hinter einer Bezahlschranke verborgenen Artikel der Kreiszeitung Wesermarsch mit der Aussage zitiert wird, er wolle noch "ein paar Jahre" Pfarrer in Nordenham bleiben, aber nicht bis zur Altersgrenze von 75 Jahren. Da Pfarrer Jasbinschek derzeit 68 Jahre alt ist, heißt das, dass er nicht die Absicht hat, noch weitere sieben Jahre in seiner jetzigen Stellung zu verbleiben. Angesichts der anstehenden Bildung "Pastoraler Räume" neige ich dazu, es für fraglich zu halten, ob Nordenham Überhaupt noch einmal einen eigenen Pfarrer bekommt. – Das Thema "Pastorale Räume" wird auch in der aktuellen Ausgabe der Pfarrnachrichten von St. Willehad (vom 27.05.) angesprochen; dort heißt es u.a.:
"Das Offizialat will Pfarreien zu pastoralen Räumen verbinden, in denen Frauen und Männer, freiwillig Engagierte und Hauptberufliche das Evangelium vor Ort verkünden und leben können. Die Pfarreien bleiben aber selbstständig im Kirchengemeindeverband [...]. Die Selbständigkeit der Pfarreien unterscheidet den Kirchengemeindeverband von den bisherigen Fusionen."
Da möchte ich mal kurz die Frage einschalten: Bezweifelt eigentlich irgend jemand ernsthaft, dass die Pastoralen Räume lediglich eine Vorstufe zu künftigen weiteren Pfarreifusionen darstellen? – Aber mal weiter:
"Für die St.-Willehad-Gemeinde Nordenham (3254 Mitglieder) ist ein Zusammenschluss mit St. Marien Brake (2359), St. Benedikt Jever (3606), St. Bonifatius Varel (3648), St. Willehad Wangerooge (188) und St. Willehad Wilhelmshaven (8370) geplant. [...] Kirchenausschuss, Pfarreirat und die Seelsorger sind weiterhin im Gespräch, wie es in unserem pastoralen Raum weitergehen wird. Wir werden berichten" –
und ich werde das weiterhin im Auge behalten.
- zu Fortbildungszwecken: Katholische Pfadfinderschaft Europas (Hg.), Zeremoniell. 5., überarbeitete Auflage 2018; Mein Probenbuch. 9., überarbeitete Auflage 2020; Der Weg durch den Dschungel – Erprobungen für die Wölflingsstufe. 7., korrigierte Auflage 2022.
Es hat sich wohl schon abgezeichnet: Der Umstand, dass mir die Aufgabe zugefallen ist, eine organisatorisch und konzeptionell an die Pfadfinder angegliederte Kindergruppe zu leiten, obwohl ich keinerlei Erfahrung oder Vorkenntnisse in Sachen Pfadfinderei habe, hat mich dazu veranlasst, mich ein wenig tiefer in die Materie einzuarbeiten. Gar nicht mal so sehr, weil das für die praktische Arbeit mit der Wichtelgruppe unbedingt notwendig wäre, sondern vielmehr, weil ich neugierig geworden bin. Also habe ich mir mal einige Materialien von der Katholischen Pfadfinderschaft Europas besorgt. – Über die Unterschiede zwischen KPE- und DPSG-Pfadfindern habe ich ja schon vor längerer Zeit etwas geschrieben, zu einem Zeitpunkt, als mir die ganze Materie nur vom Hörensagen ein Begriff war; inzwischen hatte ich aber einmal – letztes Jahr an Fronleichnam übrigens, in Teltow – Gelegenheit, einen leibhaftigen Stamm von KPE-Pfadfindern kennenzulernen, und das war eine sehr sympathische Begegnung. Was die Katholischen Pfadfinder Haselhorst angeht, gehören diese zwar (bisher) keinem Verband an, aber man darf wohl behaupten, dass sie der KPE tendenziell näher stehen als der DPSG. Zu den oben aufgeführten Materialien, in die ich mich gerade einzuarbeiten begonnen habe, wurde mir gesagt, dass es ein vergleichbares Zeremoniell bei den DPSG-Pfadfindern nicht gebe, und ebensowenig Prüfungen für den Erwerb von Abzeichen – das gelte bei der DPSG wohl als zu autoritär und zu kompetitiv. Wozu ich gleich mal anmerken möchte: Nach meiner Erfahrung stehen Kinder und jüngere Teenager total auf kompetitive Aufgaben. Vor allem Jungs, aber nicht nur Jungs.
Das Büchlein mit dem Zeremoniell der KPE wird eingeleitet durch ein Kapitel "Sieben Gründe, warum wir ein Zeremoniell haben" – was ja schon mal unterstreicht, wie wenig selbstverständlich das ist. Diese Sieben Gründe finde ich durchaus lesenswert und diskussionswürdig, allerdings können sie nicht gänzlich verhindern, dass der ganze pfadfinderische Kult um das korrekte Anlegen der Kluft, um Fahnen und Abzeichen und die Form des Grüßens meinem inneren Hippie rein vom Bauchgefühl her eine Spur zu paramilitärisch erscheint. Aber okay, wenn meine Kinder zu den Pfadfindern gehen, dann haben sie damit gleich etwas, womit sie sich von mir abgrenzen können; das soll ja in einem bestimmten Alter sehr wichtig sein, und da gäbe es bestimmt schlechtere Möglichkeiten.
Allerdings muss ich schon sagen, es leuchtet mir ein, dass die Wölflingsstufe erst mit acht Jahren anfängt. Nicht nur und nicht einmal in erster Linie wegen des Schwierigkeitsgrades der einzelnen Aufgaben, sondern allein schon wegen der Anforderungen in Sachen Disziplin, Impulskontrolle und Teamfähigkeit: Da werden Gehirnregionen beansprucht, die bei Kindern im Vorschulalter schlichtweg noch gar nicht vorhanden sind. Klingt komisch, is' aber so. Was ich damit sagen will, ist: Interessant und anregend sind die Probenbücher für die Wölflinge und für die größeren Pfadfinder allemal, und auf längere Sicht wird man damit irgendwann auch praktisch "etwas anfangen" können, aber im Rahmen der Wichtelgruppe wohl eher weniger. Gleichwohl soll die Wichtelgruppe natürlich nicht einfach nur "irgendein" Spiel- und Betreuunsgsangebot für Kinder unter acht Jahren sein, sondern in Inhalt und Form insoweit pfadfinderisch "getönt" sein, dass sie als eine Art Vorbereitung und Hinführung zum Eintritt bei den Wölflingen dienen kann. Wie sich das in der Praxis gestaltet, wird sich zeigen; wir stehen ja noch ganz am Anfang.
- als Bettlektüre: Astrid Lindgren, Kalle Blomquist [Gesamtausgabe: Drei Romane in einem Band]. Hamburg: Oetinger, 1996 [dt. erstmals 1969].
Ein Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur des 20. Jahrhunderts, und trotzdem muss ich zugeben, dass ich bisher lediglich eine alte Schwarzweiß-Verfilmung des ersten Teils kannte und mich nur an wenige Details daraus erinnern konnte. Wem es ähnlich geht, dem sei in aller Kürze erklärt, worum es geht: Titelheld Kalle ist dreizehn Jahre alt und Sohn eines Lebensmittelhändlers in einer schwedischen Kleinstadt; in den Sommerferien erlebt er allerlei altersgerechte Abenteuer mit seinen besten Freunden Anders und Eva-Lotta, vor allem aber träumt er davon, ein berühmter Detektiv zu werden, und übt sich in allerlei Ermittlungsmethoden, wie er sie aus den einschlägigen Romanen und Kinofilmen kennt. Ernst wird es, als Eva-Lottas Onkel Einar sich als Feriengast im Haus von Eva-Lottas Eltern einquartiert und sich sehr verdächtig benimmt. –
Weil uns der einziggeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen göttlich zu machen. Mehr als das: Was er von dem Unsrigen annahm, gab er ganz hin für unser Heil. Denn er brachte seinen Leib auf dem Altar des Kreuzes zu unserer Versöhnung Gott, dem Vater, als Opfergabe dar. So sollten wir von elender Knechtschaft erlöst und von aller Sünde gereinigt werden.
Damit uns aber ein Gedächtnis dieser so großen Liebe bleibe, hinterließ er den Glaubenden seinen Leib zur Speise und sein Blut zum Trank unter der Gestalt von Brot und Wein. Kein Sakrament hat eine heilsamere Wirkung als dieses: Es reinigt von Sünden, es mehrt die Tugenden und erfüllt den Geist mit dem Reichtum aller geistlichen Gaben. Es wird in der Kirche für die Lebenden und die Toten dargebracht, damit allen zugute komme, was zum Heil aller eingesetzt ist.
(Thomas von Aquin, Über das Fest des Leibes Christi)
Ohrwurm der Woche
Paul Simon, "Ace in the Hole"
Du wirst es schon bemerkt haben, Leser: Es geht mit den neuen Artikelthemen derzeit nicht so schnell voran, wie mir eigentlich lieb wäre. "Dran" wäre, den jüngsten Umfrageergebnissen zufolge, an sich das Thema "Der Traum von der erneuerten Gemeinde"; der Artikel dazu erweist sich indes als recht arbeitsintensiv, es könnte daher sein, dass ich das Dossier "Warum eigentlich 'Punkpastoral'?" vorziehe, und eventuell auch eine neue Folge der alten Serie "God Gave Rock'n'Roll to You".
Meine Liebste steckt derweil noch im Schuljahresendstress, aber in recht absehbarer Zeit müssten alle Klausuren korrigiert sein und alle Noten feststehen, und spätestens dann gibt es keine Ausreden mehr, die Wiederbelebung des Blogs "Wandern im Wellenwind" noch weiter hinauszuzögern. Stoff gibt es ja genug...!