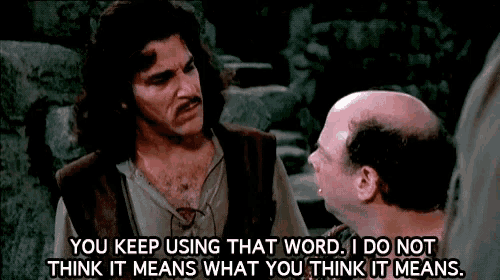Nachdem die Dossiers zum Thema "Warum eigentlich 'Punkpastoral'?" sowie zum Thema "Gemeindeerneuerung" interessierten Lesern Gelegenheit geboten haben, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie ich mir eine "christliche Graswurzelrevolution" in Grundzügen vorstelle, ist es nun wohl mal an der Zeit, einem Herzensprojekt, das meine Liebste und mich schon seit einigen Jahren umtreibt und das wir irgendwann, idealerweise noch bevor die Kinder aus dem Haus sind, verwirklichen zu können hoffen, ebenfalls ein eigenes Dossier zu widmen: dem Projekt Pfarrhausfamilie.
Für diese Projektidee gab es eine markante Initialzündung, die im Artikel "Das! Ist! Unser Haus!" vom 17. Mai 2017 dokumentiert ist: Kurz zuvor hatte ich erfahren, dass die Pfarrei St. Willehad ein ihr gehörendes Haus in Tossens – das in der betreffenden Meldung nicht ganz zutreffend als "ehem. Pfarrhaus" bezeichnet wurde – verkaufen wollte, und rein intuitiv missfiel mir das erst einmal.
"Ich bin in dieser Hinsicht wohl im Wortsinne konservativ (von lat. conservare = 'bewahren'), jedenfalls bekomme ich immer so ein nervöses Zucken um die Augenwinkel, wenn ich den Eindruck habe, dass kirchliche Einrichtungen ihren Besitz verschleudern. Und dabei geht es zunächst mal gar nicht darum, worin dieser Besitz konkret besteht. Sondern darum, dass die Entscheidungsträger in den Gremien über Dinge verfügen, die in einem ideellen Sinne nicht ihnen gehören. Sondern dem Volk Gottes als Ganzem."
Konkret auf das Haus in Tossens bezogen, schlossen sich daran die folgenden Überlegungen an:
"Natürlich, nicht genutzte Immobilien verursachen unnütze Kosten. Wenn die Kirchengemeinde also keine Verwendung für das Haus hat, was hätte sie Besseres tun können als es zu verkaufen? - Nun ja: vielleicht eine Ausschreibung für ein Nutzungskonzept machen. Wär ja mal was gewesen. Als ich auf Facebook Fotos des Hauses sah, kamen mir fast die Tränen. Was hätte man da alles machen können! Kochen und essen, Gäste beherbergen, im Garten Gemüse anpflanzen – kurz gesagt: LEBEN. [...] Und dies, die Einheit von Glauben und Leben – ob man das Konzept nun 'Punkpastoral' nennt oder 'Benedict Option' oder wie auch sonst – ist meiner festen Überzeugung nach das, was der Kirche hierzulande fehlt und worin ihre Zukunft liegen könnte. Wie schön wäre es gewesen, man hätte sich ein paar engagierte junge Leute gesucht, die das 'angegriffene' Haus in Eigenregie renovieren und dafür dann mietfrei (bzw. gegen Deckung der Betriebskosten) dort wohnen und ihre Projekte realisieren können. Gebetshaus Tossens. Träumen wird man ja wohl dürfen."
 |
| So sah es aus, das Haus. (Vom verwilderten Garten aus gesehen.) |
Bevor ich darauf komme, wie dieser Traum in der Folgezeit weiter ausgesponnen wurde, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich in diesem Blogartikel betonte, das, worum "es mir eigentlich geht", gehe "weit über diesen Einzelfall hinaus" – und in diesem Zusammenhang auf den nur einen Tag zuvor erschienenen Artikel "St. Joseph Tegel: Benedict Option anno 1919" zurückverwies; in diesem hatte ich nämlich u.a. den Umstand ins Auge gefasst,
"dass Kirchengemeinden oft über beträchtlichen Immobilienbesitz verfügen. Wo sie als Vermieter von Wohnungen fungieren, da dient dies zwar nicht selten der Querfinanzierung anderer Tätigkeitsbereiche der Pfarrei, weshalb Kirchengemeinden als Vermieter nicht unbedingt weniger gewinnorientiert agieren als andere Vermieter auch; andererseits kann man davon ausgehen, dass es eine ganze Reihe kirchlicher 'Funktionsimmobilien' (Pfarrhäuser, Pfarrbüros, Gemeindezentren etc.) gibt, die im Zuge der Bildung von Großpfarreien bzw. 'Pastoralen Räumen' ihre bisherige Funktion verlieren werden oder schon verloren haben. Ich mein ja nur."
"Sich ein Konzept dafür zu überlegen, was man in einem Haus wie diesem veranstalten könnte, kann ja nicht schaden. Haben wir ein Konzept, findet sich vielleicht auch jemand, der's macht – zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür größer, als wenn man kein Konzept hat. Und wenn es jetzt und mit diesem Haus nicht klappen sollte, wird es sicherlich in Zukunft noch Gelegenheiten geben, bei denen man so ein Konzept – mit gewissen Anpassungen – noch gebrauchen kann."
"Erst mal müsste man in Haus und Garten eine ganze Menge in Ordnung bringen, Kontakt zu den Einheimischen aufbauen und pflegen, eventuell eine Foodsharing-Initiative starten – und ansonsten für das Projekt beten. Und damit wäre dann auch schon ein Jahr rum."
Der Artikel enthält eine Reihe von Einzelideen für die Nutzung von Haus und Grundstück im weiter oben skizzierten Sinne; auch wenn genau dieses Haus für derartige Projekte heute nicht mehr zur Verfügung steht – wie ich im Kaffee & Laudes-Urlaubs-Special vom 15. Juli 2019, also rund zwei Jahre später, "am Rande" erwähnte, wurde es "inzwischen abgerissen", und nun steht "ein schickes, ein bisschen spießiges Privathaus an seiner Stelle" –, finde ich diese Passagen des Artikels zu Inspirationszwecken nach wie vor empfehlenswert. Das gilt auch und nicht zuletzt für einen Abschnitt, der sich der Frage "Und was ist nun mit dem Geld?" widmete: "Tatsächlich kenne ich niemanden, der eine Summe, die sowohl den Kaufpreis für das Haus (samt Grunderwerbsnebenkosten) als auch die nötigsten Investitionen für Instandsetzung und -haltung und die Betriebskosten für das erste Jahr abdecken würde, einfach so bei sich rumliegen hat", räumte ich ein – fügte aber hinzu: "Trotzdem bin ich der Meinung: Wären wir erst mal so weit, dass nur noch das Geld fehlt, dann würde das Geld schon irgendwo her kommen." Zur Untermauerung dieser gewagten These verwies ich auf eine Anekdote darüber, wie Dorothy Day anno 1937 eine Farm für die Catholic Worker-Bewegung erwarb.
Nachdem das Projekt Tossens sich vorerst zerschlagen hatte, tauchte in meinem Blogartikel "Techno-Hippies head for the Hills" (07. Dezember 2017) kurzzeitig die Idee auf, man könnte auch gleich ein ganzes Dorf kaufen – namentlich die Siedlung Alwine im Süden Brandenburgs, die zu diesem Zeitpunkt gerade "zu einem Startgebot von schlappen 125.000 €" versteigert werden sollte. Ich merkte seinerzeit an, mir stelle sich da "die Frage, für wen das Objekt eigentlich interessant sein soll, wenn nicht für Landkommunengründer". Über den konkreten Einzelfall der Siedlung Alwine hinaus enthält dieser Artikel aber auch grundsätzliche Erwägungen zum Thema – und insbesondere dazu, wieso ich mich überhaupt für so etwas interessiere:
"Als ich Rod Drehers Benedict Option noch nicht aus eigener Lektüre, sondern nur aus Rezensionen kannte – und zwar in erster Linie aus Luma Simms' von Skepsis geprägter Rezension im Federalist -, nahm ich zunächst an, das oder zumindest ein zentrales Thema des Buches wäre die Gründung christlicher Landkommunen. Das ist nicht der Fall – zwar heißt das 6. Kapitel des Buches 'Die Idee eines christlichen Dorfes', aber das ist eher metaphorisch gemeint: Ein solches 'christliches Dorf' kann, zumindest der Theorie nach, überall sein, auch innerhalb einer Großstadt. Schließlich geht es bei der Benedict Option – es scheint wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, denn gerade dieser Punkt wird offenbar gern und oft missverstanden, sowohl von Leuten, die das Buch nicht, als auch von solchen, die es nur auszugsweise oder oberflächlich gelesen haben – nicht darum, jeglichen Kontakt zur nicht- oder gar antichristlichen Umwelt zu meiden; davor wird sogar ausdrücklich gewarnt, da es einerseits ungesunde sektiererische Tendenzen begünstigen würde und andererseits nicht missionarisch wäre. Sehr wohl aber geht es in der Benedict Option darum, Rückzugsräume zu schaffen, in denen Christen ihren Glauben und ihre Gemeinschaft untereinander stärken können. Und in diesem Zusammenhang lässt mich die Idee eines 'christlichen Dorfes' im buchstäblichen Sinne nicht so ganz los. Auch wenn man ausgerechnet da, wo so etwas innerhalb Deutschlands wohl am ehesten zu verwirklichen wäre – in strukturschwachen Regionen der 'Neuen Bundesländer' – wohl einerseits mit der unerfreulichen Nachbarschaft Völkischer Siedler rechnen müsste und andererseits womöglich mit ungebetenem Besuch von der Antifa, die zwischen christlichen und völkischen Siedlern nicht unterscheiden kann oder will."
Nach diesem Artikel war es auf meinem Blog rund ein halbes Jahr lang eher still um dieses Thema, und als es wieder auftauchte, richtete sich mein Blick erneut eher auf Butjadingen, oder jedenfalls auf die Wesermarsch. Der Artikel "Tiny Living in Pferdeställen und Wassertürmen" vom 13. Juni 2018 wurde veranlasst durch verschiedene Wohnungsbauprojekte in Butjadingen und Brake/Unterweser sowie die Nachricht, dass in Nordenham ein über 100 Jahre alter Wasserturm zum Verkauf stand. Eher beiläufig komme ich darauf zu sprechen, warum ich mich überhaupt dafür interessiere:
"[E]igentlich habe ich ja bei leerstehenden Bauernhäusern mitsamt Nebengebäuden immer die Vision, da könnte eine Benedikt-Options-Kommune einziehen -- so ähnlich wie in dem Film 'Sommer in Orange', nur eben mit Christen, die das Stundengebet pflegen und einen Permakultur-Garten betreiben. Oder so."
Was den Wasserturm angeht, meinte meine Liebste übrigens, im Prinzip könnte man darin "ein ganzes Kloster unterbringen. Einschließlich der Kirche." Und nicht nur das: "Wenn man das Beleuchtungsproblem gelöst bekommt [...], könnte man sogar im Gebäude einen Aquaponik-Selbstversorgergarten anlegen."
Die Idee mit dem Kloster im alten Wasserturm taucht knapp zwei Wochen später in einem Artikel mit dem Titel "Wenn die Wölfe es geschafft haben, in die Wesermarsch zurückzukehren, wieso sollten es nicht auch die Mönche tun?" nochmals auf; hier sind auch einige Fotos des betreffenden Wasserturms zu bewundern. Vor allem aber findet sich hier eine Erklärung dazu, was das Stichwort "Kloster" eigentlich mit der (zu diesem Zeitpunkt noch nicht so benannten) Projektidee "Pfarrhausfamilie" zu tun hat:
"Ich gebe zu [...], dass ich mir unter einer Benedikt-Options-Kommune, mit der man ehemalige Bauernhäuser, nicht mehr genutzte Wassertürme oder vom Fortschritt vergessene ländliche Wohnsiedlungen
besetzen, äh, mit neuem Leben erfüllen könnte, bislang idealerweise eine Gruppe von Familien oder meinetwegen auch Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften vorgestellt hätte. Aber die Bemerkung meiner Liebsten, in dem zum Verkauf stehenden Nordenhamer Wasserturm könne man 'ein ganzes Kloster' unterbringen, hat mich ins Grübeln gebracht, und zwar auch über den konkreten Fall dieses Wasserturms hinaus. Könnte es sein, dass ein buchstäbliches Kloster tatsächlich der ideale Kristallisationspunkt für ein #BenOp-Siedlungsprojekt wäre? Bedenken wir, dass beispielsweise die Gemeinschaft der Tipi Loschi, die in Rod Drehers Buch immer wieder als vorbildlich gepriesen wird, in engem Kontakt mit den Benediktinermönchen von Norcia lebt. Bedenken wir beispielsweise auch, dass – wie ich in vor längerer Zeit mal erwähnt habe – die ab 1928 entstandene katholische Wohnsiedlung 'Mariengarten' im (übrigens einstmals vom Templerorden begründeten) Berliner Ortsteil Marienfelde gezielt in der Nachbarschaft eines Klosters angelegt wurde."
Und weiter:
"Stellen wir uns also mal vor, der erste Schritt zur Entstehung einer #BenOp-Community in einer strukturschwachen und religiös weitgehend verödeten Gegend wäre die Begründung eines richtigen, echten Klosters, und im nächsten Schritt würden sich dann die oben angesprochenen Familien und/oder Mehrgenerationen-WGs in der Umgebung dieses Klosters ansiedeln, um regelmäßig am Gebetsleben der Mönche (Stichwort Stundengebet) teilzunehmen, aber zum Teil vielleicht auch gemeinsam mit den Mönchen zu arbeiten. Und diese gewissermaßen an das Kloster angegliederten Laiengemeinschaften tragen dann das lebendige Zeugnis eines radikal christlichen Lebens weiter in die Umgebung hinein – ein Zeugnis gegenüber Nachbarn, Arbeitskollegen beziehungsweise Geschäftspartnern und natürlich gegenüber anderen Familien. Auf diese Weise ergäbe sich dann vielleicht tatsächlich eine Kettenreaktion".
Eine weitere bezeichnende Passage dieses Artikels lautet:
"Abgefahrene Ideen 'rauszuhauen, und zwar ohne Rücksicht auf Fragen der Realisierbarkeit, ist nun mal meine Spezialität; Alternativpläne zu entwickeln, die im direkten Vergleich plötzlich viel realistischer aussehen, kann gern jemand anderes übernehmen. Vielleicht aber ja jemand, der ohne meine Spinnereien gar nicht erst auf so eine Idee gekommen wäre. Das wäre dann ja auch eine Art Kettenreaktion."
Um das Kloster-Thema abzurunden und zugleich ein Licht auf die Frage der praktischen Realisierbarkeit zu werfen, möchte ich – der chronologischen Reihenfolge vorgreifend – auch noch auf den Artikel "Die Idee eines christlichen Dorfes... in Italien" vom 02. Juli 2019 hinweisen. Darin geht es um das Projekt eines "christlichen Gemeinschafts-Wohnprojekts für junge Familien", das in der Nähe von Mailand entstehen sollte. Auch da taucht der Gedanke auf, ideal wäre es eigentlich, ein solches Projekt in der Nachbarschaft eines Klosters anzusiedeln: "In täglichem Kontakt zu den Mönchen zu stehen, an ihrer Liturgie teilzunehmen und sie in die Bildung und Erziehung unserer Kinder einzubeziehen, wäre die schönste und beste Verwirklichung unseres Projekts", erklärt der Initiator Giovanni Zennaro, fügt allerdings hinzu, "dass es auch umgekehrt funktionieren könnte: dass Mönche eines Tages in unsere Nähe kommen" und in der Nachbarschaft des Cascina San Benedetto genannten Wohnprojekts ein Kloster gründen.
Nun aber mal zurück zur chronologischen Reihenfolge und damit in den Sommer 2018: Am 02. Juli erschien auf meinem Blog der Artikel "Für neues Leben in alten Pfarrhäusern!", der zwar einen konkreten Anlass in der Nachricht hatte, die geplante Renovierung des leerstehenden (evangelischen) Pfarrhauses im Butjadinger Ortsteil Langwarden drohe daran zu scheitern, dass der Kirchensteuerbeirat der Oldenburgischen Landeskirche einen Zuschuss in Höhe von 54.000 Euro verweigert habe; aber schon die Überschrift lässt ja darauf schließen, dass es sich um einen Grundsatzartikel zum Thema "Pfarrhausfamilie" handelt, und die grundsätzlichen Überlegungen setzen bei der Frage an, wie man so ein ehemaliges Pfarrhaus eigentlich nutzen könnte oder sollte. Das Kernstück des Artikels bildet in dieser Hinsicht ein Auszug aus dem Beitrag der Nightfever-Mitbegründerin Katharina Fassler zum "Mission Manifest"-Buch; dieser Beitrag ist der neunten "Mission Manifest"- These "Wir brauchen eine 'Demokratisierung' von Mission" gewidmet, und der Auszug, der mich da am meisten gefesselt und elektrisiert hat, findet sich dort unter der Zwischenüberschrift "Der Traum vom lebendigen Pfarrhaus". – "Ehrlich gesagt war ich ziemlich verblüfft, als meine Liebste mir die betreffende Passage [...] vorlas, denn schon zuvor hatten wir mehrfach miteinander über ähnliche Ideen beratschlagt", merkte ich an. – Im Kern geht es in Katharina Fasslers Vision darum, dass "Familien [...], die den besonderen Ruf spürten, verlassenen und verwaisten Pfarrkirchen in den unzähligen Dörfern neues Leben zu schenken", "[g]egen eine geringe Miete [...] in den dazugehörigen Pfarrhäusern wohnen" und dort "ihr geistliches Leben für die Dorfgemeinschaft zu öffnen und diese daran teilhaben zu lassen"; sie nennt die Stichworte "Bibelkreis, Stundengebet, Lobpreis, Rosenkranz, Kinderkatechese, Anbetung". Nicht der unwichtigste Aspekt dieses "Traums vom lebendigen Pfarrhaus" ist es, dass die "Pionier"-Tätigkeit der Pfarrhausfamilie eine aktivierende Wirkung auf die Gemeinde vor Ort entfalten kann und soll: "Im Dorf hat es sich mittlerweile herumgesprochen, dass sich jeder in der wiederbelebten Kirche einbringen kann und auch dringend gebraucht wird. […] Gemeinsam mit anderen Gläubigen sucht das Ehepaar im Ort begabte und zu begeisternde Mitarbeiter in der Pfarrei."
Damit ist recht gut umrissen, wie wir uns auch und gerade für uns selbst ein Leben als "Pfarrhausfamilie" vorstellen könnten und wünschen würden; konkreter wird's dann wieder rund ein Jahr später in zwei Artikeln aus dem Juli 2019, die "Neues von der Willehad-Option" versprechen. Der erste dieser beiden Artikel, mit dem Titelzusatz "Rumble on the Beach", beginnt mit einem Besuch am ehemaligen Nordenhamer Strandbad ("ich nenne es 'ehemalig', weil dort seit Jahrzehnten Badeverbot herrscht"), der Anlass zu der Überlegung bietet, "dass man an diesem Ort ja durchaus leben könnte, wenn nur die kirchliche Situation nicht so trostlos wäre, wie sie es leider ist". Daran schließt sich erst einmal eine recht ausführliche Schilderung dieser unerquicklichen kirchlichen Situation an, wobei auch das Thema Urlauberseelsorge zur Sprache kommt – was dann wiederum den Bogen zurück zum Nordenhamer Strandbad und zur Frage einer möglichen Neubelebung desselben schlägt:
"Meine Liebste jedenfalls begann schon auf dem Rückweg von unserem ersten Besuch beim stillgelegten Strandbad damit, Ideen für eine ganzjährige Strandmission zu entwickeln, nicht nur oder hauptsächlich auf Urlauber ausgerichtet, sondern auch und gerade auf die Einheimischen. Die haben eine Neuevangelisation schließlich offenkundig sehr nötig. Kein Wunder, dass ich sofort Feuer und Flamme war" –
– wobei ich es als "wenig überraschend" einschätzte, "dass unsere Vorstellungen sich erheblich von den real existierenden 'kirchlichen Angeboten' vor Ort unterscheiden":
"Wir denken da eher in Richtung 'ganze Tage am Strand verbringen, bei jedem Wind und Wetter, egal ob jemand kommt oder nicht'. Mit einem bunt bemalten Bauwagen oder Camper als Operationsbasis, von der aus man Passanten je nach Wetter kalte oder heiße Getränke anbieten und so mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Spiel-und-Spaß-Angebote müssen natürlich sein, im Sommer z.B. Hackysack oder Frisbee, im Herbst Drachen steigen lassen; aber eben auch mehrmals am Tag Gebetszeiten nach dem Stundenbuch, dazu Lobpreismusik mit Klampfe und Percussion..."
Hervorzuheben ist an diesem Artikel schließlich auch noch die Feststellung, dass "man sich, wenn das nicht bloße Spinnerei bleiben sollte, die oder der Frage stellen" müsse, "wie man ein solches Projekt finanziert bekommt":
"Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Geld ist nie das eigentliche Problem. Mit ausreichend Gottvertrauen findet sich da schon ein Weg, wir beten im Vaterunser ja nicht ohne Grund 'Unser tägliches Brot gib uns heute'."
Im zweiten Teil, dessen Titelzusatz "Warum nicht Einswarden?" lautet, liegt der Fokus auf den "von der Pfarrei aufgegebenen Kirchengebäude[n]", wobei zunächst die profanierte Kirche St. Josef in Stadland-Rodenkirchen im Fokus steht, dann aber vor allem die Kirche Herz Jesu im Nordenhamer Problemstadtteil Einswarden, auf deren Gelände meine Liebste und ich uns erst kurz zuvor einmal umgesehen hatten. Mein Urteil über die dort gewonnenen Eindrücke lautete:
"Ich übertreibe kaum, wenn ich sage: Am liebsten wären wir gleich dageblieben. Das ganze Ensemble – Kirche, Pfarrhaus, Gemeindesaal mit Küche und Toilette, eine Blockhütte und zwei Garagen, dazu ein großes Gartengrundstück – wäre geradezu ideal für ein BenOp- bzw. Punkpastoral-Projekt. Man bräuchte uns praktisch nur einen Schlüssel zu geben, und wir könnten morgen anfangen. -- Was würden wir machen? Nun, für den Anfang ließen sich diejenigen Aktivitäten, die wir derzeit in unserer Wohnortpfarrei in Berlin-Tegel betreiben, ziemlich problemlos dorthin übertragen; da die Kirche dort obendrein genauso heißt wie hier, nämlich eben Herz Jesu, könnten wir sogar das Logo weiterverwenden."
Als Aktivitäten, die sich "ziemlich problemlos dorthin übertragen" ließen, nannte ich im einzelnen das "Dinner mit Gott", den "Krabbelbrunch" ("oder meinetwegen auch 'Familienfrühstück mit Kinderspielecke'") sowie "Büchertreff" und Tauschbibliothek. Darüber hinaus merkte ich an, das Gartengrundstück "böte genug Platz, um sowohl wetterfeste Spielgeräte aufzustellen als auch Beete anzulegen, und vielleicht wäre sogar ein bisschen Kleintierhaltung möglich"; und:
"In einer der Garagen würde ich gern einen Bandprobenraum einrichten [...]. Schülerbands, die mit ihrer Musik kein Geld verdienen, sollten den Probenraum kostenlos nutzen können, sollten sich aber bereit erklären, sich, wenn sie irgendwann doch mal bezahlte Auftritte an Land ziehen, mit einer Spende erkenntlich zu zeigen. Wenn's gut läuft, kann man über kurz oder lang vielleicht einige der musizierenden Jugendlichen für eine Lobpreis-Band rekrutieren."
Zu alledem resümierte ich:
"Und das alles wäre – im buchstäblichsten Sinne – 'nur der Anfang'; will sagen, das wären die Dinge, mit denen man sofort und ohne weitere Vorbedingungen loslegen könnte. Alles Weitere würde sich dann schon zu seiner Zeit finden."
Nun haben sich diese Konzeptideen zwar in Hinblick auf dieses konkrete Objekt inzwischen zerschlagen (Ende 2021 wurde das Gebäudeensemble samt Grundstück an das Koptisch-Orthodoxe Bistum Norddeutschland verkauft, was ich in meinem Artikel "Spandau oder Portugal #4" als "unerwartet gute" Nachricht bewertete –, aber als Anschauungsbeispiel dafür, was man als Pfarrhausfamilie so alles auf die Beine stellen könnte, finde ich diesen Teil des "Warum nicht Einswarden?"-Artikels nach wie vor durchaus illustrativ. Interessant ist nicht zuletzt auch, dass dieser Artikel auf "ein gut funktionierendes Vorbild" dafür hinweist, wie aus einem vom örtlichen Bistum bereits aufgegebenen Kirchenstandort doch wieder eine Oase des Glaubens werden kann – nämlich das Beispiel "der in einem Hinterhof in Kreuzberg unweit des Anhalter Bahnhofs gelegenen Kirche St. Clemens":
"Im Jahr 2007 verkaufte das Erzbistum Berlin das 1910 erbaute Gotteshaus samt Nebengebäuden an einen privaten Investor; dieser wiederum vermietete das ganze Ensemble an einen Förderverein, der dafür sorgte, dass St. Clemens weiterhin als Kirche genutzt wird -- und zwar durch eine Ordensgemeinschaft aus Indien".
Was daraus zu lernen wäre:
"Für ein Modell wie in St. Clemens bräuchte man a) einen privaten Investor als Käufer, b) einen Förderverein als Mieter und c) eine Ordensgemeinschaft [...]. Handelt es sich um eine Ordensgemeinschaft, die den kirchenrechtlichen Status eines Institut päpstlichen Rechts hat [...], dann unterliegt sie nicht der Jurisdisktion des Ortsbischofs; strenggenommen bräuchte sie nicht einmal seine Erlaubnis für die Niederlassung. Schöner wäre es natürlich, wenn er seine Einwilligung trotzdem gäbe. Und ich schätze mal, dies wäre am ehesten dann zu erwarten, wenn die Ordenspriester die Diözese im Bereich der Gemeindeseelsorge entlasten."
Aber das geht nun eigentlich schon wieder über den Rahmen des Themas "Pfarrhausfamilie" hinaus. – Wenig Neues, nicht nur zu diesem Thema, sondern ganz generell, gab es auf meinem Blog während der Corona-Zeit; in meinem Jubiläumsartikel "Zehn Jahre 'Huhn meets Ei'" vom 26. September 2021 findet sich indes ein Absatz, der verrät, meine Liebste und ich dächten "in jüngster Zeit verstärkt darüber nach, ob es nicht allmählich an der Zeit wäre, den nächsten Schritt zu tun und mit dem schon wiederholt angedachten Projekt Ernst zu machen, mit Hilfe von Crowdfunding ein geistliches Zentrum in einem ehemaligen Pfarrhaus – oder gegebenenfalls auch in einem Resthof oder einem alten Wasserturm – aufzubauen. Das wäre natürlich ein großer und gewagter Schritt; aber wenn tatsächlich etwas daraus wird, dann kannst du sicher sein, lieber Leser: Hier erfährst du es zuerst!" Knapp zwei Monate später wird dieser Absatz in "Preview: Das neue Wochenbriefing kommt..." leicht gekürzt wiederholt. Da sieht man mal, wie sehr diese Idee uns gerade in der Corona-Zeit beschäftigte.
Mehr oder weniger offenkundig stand der Wunsch, Pfarrhausfamilie zu werden, auch für das Motto der fünfteiligen Wochenbriefing-Reihe "Spandau oder Portugal" Pate; explizit kommt dies im ersten Teil dieser Reihe (vom 29. November 2021) zum Ausdruck: Da erwähne ich, es seien "so einige Ideen und Anregungen an uns herangetragen" worden, "wo wir hingehen und was wir da machen könnten, und ich empfinde es als ausgesprochen ermutigend, innerhalb von nur einer Woche schon so viel interessantes Feedback bekommen zu haben":
"Teilweise beinhaltete das sogar konkrete Hinweise auf geeignete Immobilien. Ja, okay, in einer solchen Diskussion fiel irgendwann der Satz 'Und wo bekommen wir jetzt die 1-2 Millionen her?'. Das ist, zugegeben, keine ganz so leicht zu beantwortende Frage. Aber dann wiederum denke ich mir, na ja, sooo furchtbar viel Geld ist das ja nun auch wieder nicht. Das mag komisch klingen, besonders wenn es von jemandem kommt, der noch letzte Woche laut darüber nachdachte, wie er es anstellen könne, mit seinem Blog 500 € im Monat zu verdienen (eine Frage, die nach wie vor aktuell ist). Aber [...] wie Peter Maurin, der Mitbegründer der Catholic Worker-Bewegung, zu sagen pflegte: 'In der Geschichte der Heiligen wurde Kapital durch Gebet aufgebracht. Gott sendet dir, was du brauchst, zu der Zeit, wenn du es brauchst. Lies einfach die Lebensgeschichten der Heiligen.'"
Ein anderes schönes Detail dieses Artikels ist es, dass "meine Liebste unlängst [...] geträumt" hatte,
"wir würden als Selbstversorger in Portugal leben -- mit vier Kühen: 'Kühe sind schließlich Herdentiere, und weniger als vier wären keine Herde.' Sie habe sich allerdings, so erzählte sie weiter, schon im Traum gefragt, 'was wir eigentlich mit der ganzen Milch machen, und ob ich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt sein will, Käse zu machen -- ich hab' schließlich auch noch was anderes zu tun.' Was sie indes nicht davon anhielt, anschließend darüber zu sinnieren, dass man ja vielleicht auch Ponys halten und damit vielleicht über Reitbeteiligungen sogar Einnahmen generieren könnte. (Auf Twitter schrieb ich vor einiger Zeit mal, als Geschäftsmodell erinnerten mich Reitbeteiligungen an das Zaunstreichen bei Tom Sawyer; die Reaktionen, die ich für diesen Tweet erntete, zeigten mir, dass ziemlich viele Leute intuitiv verstanden hatten, wie ich das meinte.)"
Gleichzeitig wird betont, "dass die Option 'ganz woanders hingehen' ja nicht unbedingt gleich 'Portugal' bedeuten müsse":
"Insbesondere mit Blick auf die Idee, am Camino Portugues eine Pilgerherberge zu eröffnen, regte eine befreundete #BenOpperin aus Norddeutschland an, es müsse ja nicht unbedingt der Jakobsweg sein: Alte Pilgerwege gebe es schließlich so ziemlich überall in Europa. Und das stimmt natürlich."
Als ich meinen Blog, nachdem er eine ganze Weile brachgelegen hatte, im März 2023 wiederbelebte, stellte ich sogleich – nämlich in "Ansichten aus Wolkenkuckucksheim #21" – klar, die Tatsache, dass die Alternative "Spandau oder Portugal" bis auf Weiteres im Sinne der ersteren Option entschieden worden sei, bedeute nicht, dass die Option Portugal damit endgültig "vom Tisch" sei:
"Erst kürzlich hat meine Liebste sich einen Pilgerführer für den Caminho Português – den portugiesischen Jakobsweg – gekauft, mit der expliziten Absicht, zu prüfen, wo ein strategisch günstiger Ort wäre, um eine Pilgerherberge zu eröffnen."
Weiter unten im selben Artikel führte ich aus, der "Wunschtraum, 'irgendwann mal' – und sei es im Rentenalter – eine Herberge für Jakobspilger zu eröffnen und zu leiten", bewege meine Liebste "wohl schon länger, als wir uns kennen; seit unserem gemeinsamen Jakobsweg im Sommer 2016 ist das jedenfalls immer mal wieder Gesprächsthema zwischen uns gewesen", und nach all den in früheren Blogartikeln dokumentierten konzeptionellen Überlegungen zum Modell "Pfarrhausfamilie" äußerte ich mich überzeugt, die Pilgerherbergen-Idee lasse sich "sicherlich unschwer mit anderen Aspekten" des Traums vom lebendigen Pfarrhaus verbinden. "Und etwas in der Art wollen wir mittelfristig auf jeden Fall machen", resümierte ich. "Das muss natürlich nicht unbedingt am portugiesischen Jakobsweg sein, aber es könnte immerhin."
Die Absichtserklärung "Etwas in der Art wollen wir mittelfristig auf jeden Fall machen" gilt wohlgemerkt nach wie vor; neue Impulse hierfür hat uns im vergangenen Jahr die – im Artikel "Im Tal von Achor" geschilderte – Entdeckung beschert, dass es im Kreis Teltow-Fläming südlich von Berlin einen Hof gibt, "der von einer christlichen Initiative zu einer Begegnungsstätte und einem 'Ort kirchlichen Lebens' (wie das im Pastoralkonzept des Erzbistums Berlin genannt wird) aus- und umgestaltet" wurde und wird: Genauer gesagt hat diese Initiative "Teile eines denkmalgeschützten Dreiseitenhofs instandgesetzt" und betreibt dort "einen 'lebendigen Ort der Begegnung' [...] mit Gästezimmern und Seminarräumen, einer großen Gemeinschaftsküche, einem Gottesdienstraum, einer Anbetungskapelle und einem Blumen-, Obst- und Gemüsegarten". Noch bevor ich diesen Hof – zuerst zusammen mit meinem Jüngsten, dann noch einmal mit beiden Kindern – persönlich besuchte, lautete mein Eindruck, dort sei "Manches von dem verwirklicht, was meiner Liebsten und mir seit ein paar Jahren als Projektidee/Vision/Lebensmodell unter dem Arbeitstitel "Pfarrhausfamilie" im Hinterstübchen herumgeistert; oder zumindest" habe "das Projekt 'Achorhof' ausreichend Ähnlichkeit mit unserer Vision [...], dass man sich da einige Anregungen erhoffen konnte". Die eigene Anschauung hat diesen Eindruck bestätigt, und ich will da unbedingt auch mal zusammen mit meiner Liebsten hin. Vielleicht in den Osterferien...
Den aktuellsten Stand der Dinge, was unsere Ambitionen angeht, selbst "Pfarrhausfamilie zu werden", fasst der Artikel "Hl. Simon und Hl. Judas, bittet für uns!" vom 15. November 2024 dahingehend zusammen, "die Idee, irgendwo auf einem Resthof in der Pampa oder wahlweise in einem ungenutzten Streckenwärterhaus einen eigenen 'Ort kirchlichen Lebens' aufzubauen, wie man das im heutigen Pastoralsprech nennt", sei "erst mal ein bisschen in den Hintergrund gerückt"; das bedeute jedoch "nicht, dass wir derartige Pläne aufgegeben hätten":
"Irgendwo eine Art von Mischung aus Nachbarschaftszentrum, Pilgerherberge und Exerzitienhaus zu betreiben, ist im Prinzip nach wie vor unser Ziel, derzeit aber ein eher längerfristiges Ziel. Dabei spielt es auch eine Rolle, dass unser Tochterkind jetzt zur Schule geht, dort ausgesprochen 'gut angekommen' ist und dass man eine Schule wie diese wohl nicht so leicht ein zweites Mal findet. Unser Jüngster ist jetzt schon sicher, dass er auch auf diese Schule gehen will, und hat wohl auch gute Aussichten auf einen Platz. Eine wirklich umwälzende Veränderung unserer allgemeinen Lebenssituation ist also im Moment, und für die nächsten Jahre, erst mal nichts, was wir aktiv anstreben."
– Wozu abschließend noch zu sagen wäre: Nicht aktiv anstreben schließt natürlich nicht aus, dass sich plötzlich und unerwartet von irgendwoher eine Möglichkeit auftun könnte, diese Vision zu verwirklichen. Womöglich sogar – träumen darf man ja – direkt oder indirekt ausgelöst dadurch, dass jemand dieses Dossier liest. Sollte also innerhalb der nächsten Jahre jemand auf uns zukommen und sagen "An Ort X gibt es so ein Haus, da könntet ihr einziehen, in der örtlichen Kirchengemeinde mitarbeiten und eure Ideen umsetzen", dann wäre das zweifellos etwas, was man prüfen und im Gebet erwägen müsste. Und falls dies nicht passiert, besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass der eine oder andere Leser sich von dem Konzept "Pfarrhausfamilie", wie ich es hier skizziert habe, angesprochen fühlt und für sich selbst die Möglichkeit sieht, einzelne oder mehrere Aspekte davon so oder so ähnlich umzusetzen. Sollte das der Fall sein, bitte ich um Rückmeldung!