 |
| Symbolbild, aufgenommen Anfang Februar in Nordenham. |
Was nun die Rede von J.D. Vance auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz angeht, habe ich, wie wahrscheinlich viele Menschen, zuerst die Aufregung darüber wahrgenommen und dann zur Kenntnis genommen, was er tatsächlich gesagt hat. Und nachdem ich letzteres im vollen Wortlaut nachgelesen habe, muss ich sagen: Im Detail kann man da Manches übertrieben bzw. überspitzt dargestellt finden, aber im Großen und Ganzen sehe ich nicht, wie man ihm widersprechen sollte. Dass unsere Spitzenpolitiker einigermaßen pikiert auf die Rede reagiert haben, ist menschlich wohl verständlich; aber wenn sie – allen voran natürlich Robert Habeck, aber, in etwas zurückhaltenderer Diktion, auch Kanzler Scholz und sein voraussichtlicher Nachfolger Merz – Trumps Vize im Grunde das Recht absprechen wollen, sich so zu äußern, beweisen sie damit im Grunde nur, wie sehr er mit seiner Kritik am Zustand von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Auf X, der App formerly known as Twitter, kommentierte J.D. (als "friend of a friend" nenne ich ihn jetzt einfach beim Vornamen, das ist bei den Amis so üblich) die Empörung über seine Rede pointiert: Wenn die Sorge um die Demokratie, die er ausgedrückt habe, als Angriff auf die Demokratie aufgefasst werde, müsse man sich fragen, ob seine Kritiker überhaupt wissen, was das Wort Demokratie bedeutet.
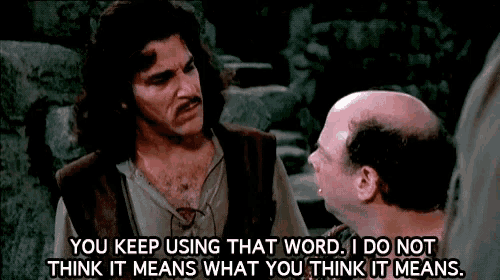 |
| (Quelle: Tenor.com) |
Mit dem Zustand von Demokratie und Meinungsfreiheit in unserem Land befasst sich auch Johannes Hartl in einem Beitrag auf Facebook und Instagram – in einem Format, das er gern verwendet: einer Bildergalerie aus Texttafeln, auf denen jeweils nur ein bis zwei oder höchstens mal drei Sätze stehen. In diesem Fall Sätze wie "Demokratie bedeutet das Recht der anderen, für etwas einzutreten, was Du total bescheuert findest" und "Meinungsfreiheit bedeutet das Recht der anderen, das zu sagen, was Du nicht hören willst." Hartl warnt davor, politische Gegner – oder überhaupt Menschen, die anderer Meinung sind als man selber – automatisch für dumm oder böse zu halten (und den eigenen Standpunkt ebenso automatisch mit dem "Guten und Gescheiten" schlechthin zu identifizieren). Ein rundum besonnener und vernünftiger Appell, sollte man meinen – aber zahlreiche Social-Media-Nutzer hatten nichts Wichtigeres zu tun, als darunter (sinngemäß) "Ja, aber die AfD...!!" zu kommentieren. Hartl selbst reagierte – auf Instagram – mit "Erstaunen" auf diese "Reihe von Kommentaren, die reflexhaft irgendetwas über die AfD antworten":
"Ernsthaft: können wir uns nicht generell über ein dialogorientiertes Miteinander verständigen, ohne immer sofort nur über Parteien zu sprechen? [...] Dass unsere Reaktion auf [...] 'lass uns Menschen nicht verteufeln' [...] reflexhaft wieder einmal nur parteipolitisch in eine bestimmte Richtung ist, scheint mir ein Symptom des von mir beschriebenen Problems. Eine entspanntere und auch lösungsorientiertere Debatte bekommen wir nur, wenn wir den Dialog suchen, offen streiten und widersprechen, doch aufhören, das Böse, Dumme und Falsche immer nur bei den anderen zu suchen."
Als Reaktion auf diesen Appell – man ahnt es bereits – erntete Johannes Hartl erneute Forderungen, er solle sich endlich mal glaubwürdig von der AfD distanzieren. Seufz.
"Sonntag abend wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Wir schaffen deshalb einen Raum um online zusammenzukommen, unsere Gefühle über das Ergebnis teilen und gemeinsam neuen Mut und Kraft schöpfen."
Da möchte man ja mal Mäuschen spielen – oder vielleicht auch lieber nicht. Man könnte ja meinen, wenn sie sich schon ausdrücklich als christliche Initiative bezeichnen, stünde es den Christians for Future gut an, zu gemeinsamem Gebet am Wahlsonntag aufzurufen; aber was sie tatsächlich im Sinn haben, sieht dann ja wohl eher nach Gruppentherapie aus. Woran erinnert mich das? – Im Baumhaus, das ich ja bekanntlich sehr schätze, gab es mal eine Veranstaltung namens "Klima-Café" (oder so ähnlich), deren Zweck es ausdrücklich sein sollte, dass die Teilnehmer sich über ihre Gefühle angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel austauschen sollten. Das fand ich auch schon eher unfreiwillig tragikomisch, aber das war immerhin live und nicht online, so als hätten wir immer noch Corona. – So oder so, würde ich sagen, bietet der virtuelle Cry Room der Christians for Future Anlass, über das therapeutische Element im Politikverständnis und politischen Aktivismus der woken Linken zu reflektieren. Irgendwie geht es immer, mehr oder weniger deutlich, um emotionale Verletzungen, die man von anderen validiert bekommen möchte, auch wenn man sich diese emotionalen Verletzungen dafür erst mal selbst zufügen bzw. einreden muss. Was mich daran erinnert, dass schon seit längerer Zeit Christopher Laschs "Zeitalter des Narzissmus" auf meiner Liste von Büchern steht, die ich "irgendwann mal lesen will". Ich glaube, das könnte sich als sehr aufschlussreich erweisen.
Im Übrigen ging mir heute Morgen auf dem Klo der von mir schon öfter bemühte Vergleich der Bundestagswahl mit der Fußball-WM durch den Kopf, und dabei stellte ich fest, dass diese Events noch mehr miteinander gemeinsam haben als nur den Umstand, dass sie in der Regel alle vier Jahre stattfinden und auch Leute mitreißen, die sich sonst kaum oder überhaupt nicht für Fußball bzw. Politik interessieren. Zu dieser Analogie gehört natürlich auch, dass Leute, die eigentlich überhaupt keine Ahnung von Fußball bzw. Politik haben, sich plötzlich berufen fühlen, über alles Mögliche mitzureden; man kann die Analogie aber noch weiter treiben: Für Leute, deren einzige Form politischer Betätigung darin besteht, "in jedem vierten Jahr ein Kreuz zu malen", wie Franz Josef Degenhardt sang, haben die Wahlen naturgemäß einen anderen Stellenwert, einen anderen Nimbus von Wichtigkeit als für solche, die noch anderweitig politisch aktiv sind. Auch das ist im Fußball ähnlich. Wer fleißig den Politikteil der Tageszeitung liest und im Fernsehen politische Diskussionssendungen und womöglich sogar Liveübertragungen von Parlamentsdebatten anschaut, wäre in dieser Hinsicht dem Fußballfan vergleichbar, der das ganze Jahr über die Bundesliga und womöglich auch noch ausländische Ligen verfolgt, daher natürlich eine begründete Meinung dazu hat, wer in der Nationalelf spielen sollte und wer nicht, sich zugleich aber auch bewusst ist, dass Welt- und Europameisterschaften letztlich nur ein Schaufenster sind, in dem die Spieler ihren Marktwert demonstrieren wollen, und dass die wirklich große Kohle im Vereinsfußball gemacht wird. Wer schließlich selbst auf lokaler Ebene politisch aktiv ist, sei es in einer Partei, einer Bürgerinitiative oder einem Nachbarschaftsverein, könnte mit jemandem verglichen werden, der selbst im Verein Fußball spielt oder vielleicht eine Jugendmannschaft trainiert. Für diesen wird die Fußball-WM möglicherweise auch ein großes Ereignis sein, bei dem er mitfiebert und das sein Herz höher schlagen lässt; vielleicht wird er aber auch der Meinung sein, dieses Event habe sich allzu weit von seinen Wurzeln entfernt und es gehe da weit mehr um Showbusiness, Ideologie und Werbeverträge als um Fußball. Bei manchen trifft vielleicht sogar beides gleichzeitig zu.
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass es auch beim JAM-Elterncafé am vergangenen Mittwoch um Politik ging; genauer gesagt um die Frage "War Jesus politisch?", was natürlich die Folgefrage implizierte, ob Christsein politisch ist oder sein sollte. Ich stieß erst spät dazu, da es mich zunächst mehr interessierte, was den Kindern währenddessen über das Buch Daniel beigebracht wurde; meinen somit eher fragmentarischen Eindruck von der Diskussion im Elterncafé würde ich als durchwachsen bezeichnen: Erfrischend, wenn auch nicht unbedingt überraschend, fand ich es, bei den Freikirchlern eine erheblich größere Distanz zum gesamten Politikbetrieb festzustellen, als man es aus den Großkirchen gewohnt ist; für die Teilnehmer der Gesprächsrunde (oder jedenfalls einige von ihnen) schien es keineswegs ausgemacht, ob es überhaupt ratsam ist, sich mit Politik zu befassen. Als ebenfalls typisch freikirchlich, aber in einem weniger erfreulichen Sinne, empfand ich die von einem naiv-oberflächlichen "sola scriptura"-Verständnis geprägte Form der Auseinandersetzung mit dem Für und Wider: Da wurden unsystematisch und kontextfrei einzelne Bibelstellen einander gegenübergestellt, wobei am Ende einigermaßen folgerichtig nicht viel mehr herauskam als "Das kann man so oder so sehen". Gut fand ich hingegen das Schlussplädoyer der neuen Elterncafé-Leiterin (die übrigens durchblicken ließ, sie habe früher durchaus einen Hang zu politischem Radikalismus gehabt, und wenn sie nicht Christ geworden wäre, würde sie "heute vielleicht im Schwarzen Block marschieren oder [s]ich auf der Straße festkleben"), denn dieses Fazit erinnerte mich an die "antipolitische Politik" der Benedikt-Option: Jenseits von der Teilnahme an Wahlen, von etwaigen Parteipräferenzen o.ä. sei Christsein insofern politisch, als Christen einfach dadurch, dass sie in ihrem alltäglichen Leben Jesus nachzufolgen suchen, in die Gesellschaft hinein wirken.
Ich finde, das ist jetzt ein echt schönes Schlusswort, und vielleicht können wir uns ab Montag alle mal wieder etwas mehr auf diese Form der politisch-gesellschaftlichen Teilhabe konzentrieren.
Tut mir leid, aber was der jetzige US-Präsident vorhat, nämlich mit dem Aggressor Putin allein zu verhandeln *über* die Ukraine aber *ohne* die Ukraine (und auch ohne die bisherigen europäischen Partnerstaaten) und Russland bereits vorab Zugeständnisse in Aussicht zu stellen, grenzt für mich an Unfairness und Verrat US-Amerikas an einem bislang von diesem unterstützten Staat und dessen Bevölkerung und natürlich auch an Westeuropa, welches z.B. seinerzeit seinen Partnerpflichten gegenüber den USA beim Afghanistan-Einsatz nachgekommen ist.
AntwortenLöschenDas Ergebnis könnte verheerend sein.
Wer kann und wird den USA und deren Bündniszusicherungen denn dann künftig noch trauen können?
Offenbar liegen die Linke, BSW oder auch AfD dann ja doch nicht so falsch, wenn sie sich Russland zuwenden wollen - werden zumindest manche jetzt meinen und entsprechend wählen.
Für einen überzeugten und zugleich wertkonservativen Christen gibt es diesmal nur EINE realistische Wahl.
AntwortenLöschenEiner Splitterpartei oder gar einer Satire(partei)gruppe die Stimme zu geben, ist ein leichtfertiges Verschenken der Stimme und allenfalls aus einer gewissen Ratlosigkeit oder Verärgerung angesichts des Politikbetriebes zu verstehen - jedoch nicht zu respektieren - jedenfalls nicht für einen WACHEN (nicht etwa "woken") Christen.
Die ganzen mehr oder weniger linken Parteien (angefangen bei SPD über Grüne, Linke zum BSW hin) kommen für gläubige Christen wg der Unvereinbarkeit ihrer Wahlprogramme mit den Christentum ebenfalls nicht in Frage. Sie sind zudem in Teilen oder ganz absolut antichristlich - ihre Wahl ist für wertkonservative gläubige Christen daher SÜNDE.
Die AfD ist ebenfalls für echte gläubige und wertkonservative Christen KEINE Option, obwohl sie versucht, mit manchen ihrer Positionen gerade auch Christen für sich einzunehmen.
Die FDP ist zwar keine linke Partei aber auch zumindest z.T. FÜR Abtreibung und ist hauptsächlich für die Interessen der Besserverdienenden wie Mittelstand oder noch reichere Menschen und deren Interessen. Zudem ist die FDP in ihrem Kern antiklerikal, antikirchlich und christentumskritisch eingestellt - somit für normalverdienende Christen ebenfalls keine vernünftige Wahloption.
Bleiben nur die Unionsparteien CDU bzw. CSU.
Ich verstehe zwar die Vorbehalte gerade konservativ eingestellter Christen nach den enttäuschenden Erfahrungen gerade auch der Merkel-Ära.
Aber unter Merz kehrt die Union wieder zurück zu ihren angestammten Positionen, auch wenn sie leider nach der Wahl in den Koalitionsverhandlungen mit anders tickenden Partnern wird Kompromisse eingehen müssen und für Christen vielleicht schmerzliche bzw. ärgerliche Zugeständnisse machen müssen.
Aber 3s gibt für konservative Christen KEINE Alternative zur Union.
Nun, ich nehme an, Sie sind nach reiflicher Überlegung zu dieser Überzeugung gelangt. In diesem Fall sollten Sie natürlich unbedingt die Union wählen. Sie sollten dabei aber bedenken, dass andere Wahlberechtigte nach ebenso reiflicher Überlegung zu anderen Überzeugungen gelangen und entsprechend wählen (oder auch nicht wählen). Und es ist nicht an Ihnen, darüber zu urteilen.
LöschenIch nehme an, dass Sie als gläubiger Katholik anders gewählt haben, d.h. nicht die Union, sondern vielleicht doch eine Splitterpartei oder etwa ungültig?
LöschenNicht nur mich würden an sich schon doch Ihre persönlichen Gründe für Ihre Wahl interessieren, obwohl es mich ja letztlich nichts angeht und ich auch selbstredend keinen Anspruch auf Offenlegung habe.
Sie müssen das (Ihre persönliche Entscheidung bei dieser Wahl) mit Ihrem Gewissen als katholischer Christ, Ehemann und Familienvater ausmachen.
Ich habe hier nur *meine* Sicht der Dinge dargelegt, und wenn Ihnen das vielleicht irgendwie unangenehm ist, sollten Sie vielleicht doch mal in sich gehen und bei sich nach den Ursachen dafür forschen.
Ich habe eine Weile gezögert, diesen Kommentar freizuschalten, aber dann dachte ich mir: Wenn ich das schon lesen musste, sollen andere es auch.
LöschenMehr möchte ich dazu lieber nicht sagen.
Gebe zu: Ich habe nicht an die Verhältnisse jeweils vor Ort, z.B. Berlin, gedacht. Sondern nur meine hiesige Situation.
LöschenDafür entschuldige ich mich - denn woanders könnte es auch gerade für Wähler wie mich ganz anders aussehen.
An sich bin ich mit dem Wahlergebnis unter den gegebenen Umständen zufrieden. Für die Union war offenbar nicht mehr drin, denn immer noch macht ein großer Teil der Bevölkerung gerade auch die CDU/CSU für die durch die Kanzlerin Merkel ausgelöste weitgehend unkontrollierte Massenmigration verantwortlich, wie Jörg Schoenenborn an Hand einer entspr. Grafik gestern Abend im Fernsehen überzeugend darlegte. Die Leute trauen halt gerade auch der neuen CDU unter F. Merz noch nicht über den Weg, dass sie die entspr. Fehler von Merkel wirklich nachhaltig korrigieren.
AntwortenLöschenImmerhin: Da das BSW nicht in den BT gekommen ist, braucht es keine sog. Jamaica-Koalition unter Beteiligung der Grünen, in der das Regieren des neuen Kanzlers ungleich schwieriger würde. So reicht eine 2er-Koalition aus Schwarz-Rot. Meine Nachbarin, seit Jahrzehnten SPD-Stammwählerin, braucht also keine Angst vor Kriegstreiberei (Taurus an Ukraine) durch F. Merz zu haben, denn die SPD-Genossen können das kontrollieren, wenn gewollt.
Das jetzige Ergebnis mit dem Desaster für SPD und Grüne haben sich diese beiden Parteien, denke ich, selbst zuzuschreiben, denn sie haben mit ihrem strammen Linkskurs bei den Migrationsbegrenzungs-Abstimmungen einen erheblichen Teil der eigenen Klientel vergrault, statt durch zumindest Abstimmungsfreigabe ohne Fraktionszwang der AfD ein Wahlkampfthema abzunehmen. Zum Teil sind die mit ihrer Wahl zur AfD gegangen, zum anderen Teil haben sie durch die Mobilisierung der Straße zahlreiche SPD bzw. Grünen-Wähler so sich der Linkspartei zugewandt, das kam gestern alles bei Wählerwanderungsgraphiken im Fernsehen heraus. Man hat ähnlich gravierende Fehler gemacht wie vor 3 Jahren A. Laschet. Tja, wer nicht hören will (, was das Volk zum großen Teil will,) muss (Wahlverluste) fühlen. Bleibt zu hoffen, dass jetzt nach der Party zumindest die SPD aus der Niederlage lernt und zur Vernunft kommt.